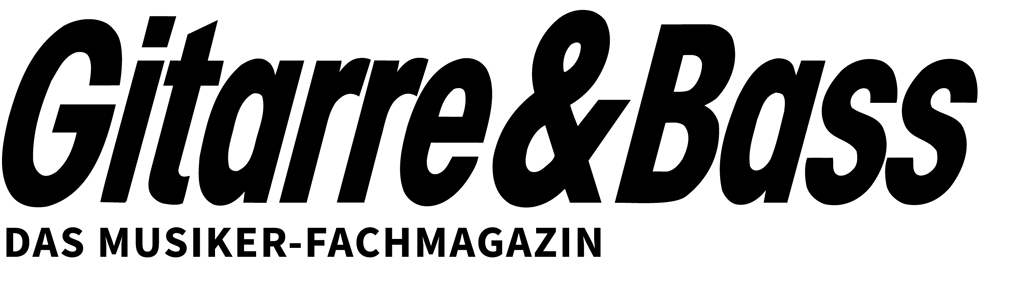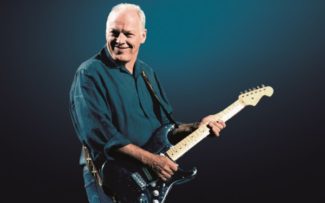Die Geschichte von Martin Guitars
Obwohl schon 37 Jahre alt, wagte auch der Gitarrenbauer Christian Friedrich Martin (1796 – 1873) den Sprung von Markneukirchen nach Amerika.

Martin hatte sich zunächst als Musikinstrumenten-Importeur in New York eingerichtet, ehe er 1839 acht „acres“ Land in Cherry Hill nahe Nazareth, Pennsylvania, erwarb, um dort seine Produktion von Martin Guitars aufzubauen.
Auch Landsmann Heinrich Anton Schatz (1806 – 1867) sah sich in erster Linie als Gitarrenbauer. Das Timing für eine Verlagerung hätte für die beiden Vogtländer nicht besser gewählt sein können, befand sich doch Amerika seit den 1830er-Jahren im Zeichen einer Guitarmania.
In New York machten „Martin & Schatz” daher bald als „Manufacturers of the celebrated Spanish and Vienna warranted Guitars” auf sich aufmerksam. Der mittlerweile zum Haupthandelspartner für Martin gewordene Charles August Zoebisch jun. (1824 – 1911) in New York berichtete 1869 nach Nazareth über die Machenschaften des Handelshauses von Charles Bruno (1800 – 1884).
Bruno habe einige von Martins Erzeugnissen als Muster ins Vogtland geschickt, um sie dort nachbauen zu lassen. Zoebisch konnte Martin aber beruhigen, dass die Europäer niemals mengenmäßig in der Lage wären, den amerikanischen Markt mit qualitativ hochwertigen Martin-Kopien zu bedienen.
„All want those Neukirchen guitars“ – dieses Eindrucks konnte sich nichtsdestotrotz der Musikalien-Gigant Lyon & Healy nicht erwehren. Der Handel mit Europa blieb ein gutes Geschäft. Die Musikinstrumenten-Metropole Markneukirchen avancierte zum größten Stapelplatz für Musikinstrumente in Europa, an dem 1893 sogar eine eigene US-Konsularagentur eröffnet wurde.
Heute erfreut sich das Unternehmen Martin Guitars stetem Wachstum und gilt als erste Adresse für Westerngitarren. Die Produktion in Pennsylvania wurde zeitweise, um der asiatischen Konkurrenz zu begegnen, um eine Fabrik in Fernost erweitert. Diese Modelle wurden als Sigma Guitars verkauft. Einige kleinere Unternehmen, wie die Darco String Company, gehören heute ebenso zu Martin Guitars.
Dr. Christian Hoyer
Hier ein Einblick in die Produktionsstätte in Nazareth, Pennsylvania:
Martins Orchestra Model
Was ist eine OM?
Eine OM ist eine Gitarre mit 000-Korpus, Hals-Übergang am 14. Bund, langer 25,4″-Mensur, und einer Halsbreite von etwa 44,45 mm am Sattel. Vintage-korrekte Modelle haben einen breiten Saitenabstand von 58,74 mm oder sogar 60,32 mm am Steg.
Verwirrend wird es, wenn man die 000s, die vor und nach der originalen Produktion der OM gebaut wurden, vergleicht: Die älteren 12- Fret-000s hatten die lange Mensur, spätere (ab etwa 1934) 14-Fret-000s traditionell die kurze, 24,9″- Mensur. Diese Tradition wurde allerdings von Martin selbst gebrochen, als die Firma Anfang der 90er-Jahre 14-Fret-000s mit langer Mensur, jedoch schmalen (42,86 mm) Hälsen anbot – also die gleichen Hals-Dimensionen einer Dreadnought.
Bei neueren Martins gilt es also aufzupassen, da 14-Fret-000s sowohl lange als auch kurze Mensuren besitzen können. Dazu gibt es auch noch Hersteller, die speziell „Short-Scale“-OMs anbieten, die dadurch dann eigentlich wieder zur eher traditionellen 14-Fret-000 mutieren.
Hier siehst Du eine OM in Action:
Die Geschichte der OM
Das Orchestra Model (OM) wurde 1929 vorgestellt, und es ist sicher nicht übertrieben, diese Gitarre als erste moderne Steelstring-Flattop zu bezeichnen. Während frühere Steelstrings noch weitgehend auf aus Europa importierten Konzert-Gitarren basierten, so war die OM ein von Grund auf ein neues Instrument, das eine ganz neue Epoche des amerikanischen Gitarrenbaus einleitete – die Ära der Westerngitarren.
Umso erstaunlicher, dass das Design, das wir heute als OM schätzen, ursprünglich schon 1934 wieder ad acta gelegt und erst in den 1970er-Jahren wieder aufgelegt wurde. Hier ein paar Highlights, die die OM damals so einzigartig machten:
Die erste Martin mit Halsübergang am 14. Bund, die erste Martin mit Stimmmechaniken an einer massiven Kopfplatte (anstatt einer Fensterkopfplatte), die erste Martin mit schmalerem Hals und die erste Martin mit serienmäßigem Pickguard – alles Features also, die wir heute als Standard ansehen.
Der Anstoß zu all diesen Features kam nicht von Martin selbst, sondern von einem Banjo-Spieler namens Perry Bechtel. Der sah das Ende der Banjo-Orchester kommen, die seit der Jahrhundertwende große Popularität genossen hatten, und wie viele andere Banjo-Spieler begann er auf die Gitarre umzusatteln.
Zwar hatte er bereits eine Gibson L-5 Archtop, jedoch gefiel ihm der Sound einer Flattop besser, wobei ihm jedoch die kürzeren und auch breiten 12-Fret-Hälse Probleme bereiteten. Also schrieb Bechtel einen Brief an Martin und schlug vor, eine Flattop-Gitarre zu bauen, die Banjo-Spieler wie ihm entgegenkommen würde.
Martin war klar, dass Bechtel nicht der einzige Banjo-Spieler sein würde, der nach einem neuen Gitarren-Design sucht, allerdings wollte man auch nicht das Rad komplett neu erfinden. Also versuchte man zunächst, Bechtels Wünschen mit Elementen existierender Modelle entgegenzukommen.
Da die 000-28 das Modell mit der längsten bereits vorhandenen Mensur war, entschied man sich, dieses als Basis für die neue Entwicklung zu verwenden. Zwar war die 25,4″-Mensur (645,2 mm) immer noch kürzer als bei vielen Banjos, aber wahrscheinlich scheute sich Martin, komplett neue Griffbretter herzustellen.
Den Hals etwas schmaler zu bauen, war natürlich ein leichtes Spiel, und die Entscheidung fiel auf 44,45 mm Breite am Sattel (bisher waren ca. 47,62 mm üblich), wobei der alte Saitenabstand von 65,5 mm am Steg beibehalten wurde. Da Bechtel seine gewohnten Banjo-Stimmmechaniken an der Gitarre haben wollte, kam erstmals eine massive Kopfplatte zum Einsatz.
Der neue Hals/Korpus-Übergang war schwieriger zu lösen. Martin hatte bereits einige viersaitige Tenor-Gitarren mit 14-Fret-Hälsen gebaut, aber durch die Verwendung der gleichen Bodies wie bei 12-Fret Modellen rückte der Steg sehr nahe an das Schallloch, was optisch den Ansprüchen nicht genügte. Also musste ein kürzerer Korpus her, und anstatt ein komplett neues Design zu zeichnen, wurden einfach die Schultern abgeflacht, um Raum für die zwei extra Bünde zu schaffen.
Der OM-28 wurde kurze Zeit später eine preiswertere OM-18 mit Mahagoni-Rücken und -Zargen zur Seite gestellt, die auch mit einem Shaded-Sunburst-Finish erhältlich war und sich ebenfalls auf Anhieb sehr gut verkaufte.
Am oberen Ende des Preisspektrums gab es dann ab 1930 auch eine mit Perlmutt und Abalone bestückte OM-45.
Mit ihrem vollen Klang und der leichten Spielbarkeit wurde die OM schnell über ihre ursprüngliche Zielgruppe hinaus beliebt. Besonders die gerade populär werdenden Singing Cowboys in den unzähligen Westernfilmen dieser Zeit fanden Gefallen an der auffälligen OM-45, was Martin dazu brachte, mit der OM-45-Deluxe eine noch stärker verzierte Variante vorzustellen.
Obwohl nur 12 oder 13 Exemplare dieser Gitarre gebaut wurden (von denen heute noch 11 bekannt sind), wurde sie als Standard-Modell im Katalog von 1930 geführt. So ist die OM-45 Deluxe bis heute die extravaganteste Gitarre, die Martin jemals außerhalb von Custom- oder Limited-Edition-Instrumenten angeboten hat.
Ob Gitarristen 1934 dem Ende der OM nachtrauerten, ist heute unmöglich zu sagen. Aber feststeht, dass das Design 30 Jahre später während des Folk-Revivals von einigen Aficionados wiederentdeckt wurde.
Gitarristen wie Roy Bookbinder, Stefan Grossman, Dale Miller und Eric Schoenberg fingen an, nach alten OMs zu suchen, die zwar aufgrund der relativ geringen Stückzahlen, die in den vier ersten Produktionsjahren gebaut worden waren, nicht unbedingt leicht zu finden waren, aber dennoch als alte, gebrauchte Gitarren ohne besonderen Sammlerwert gehandelt wurden.
Gleichzeitig erkannten einige Händler, dass Martins aus der Vorkriegszeit oft besser waren als solche, die in den 60er-Jahren hergestellt wurden. Leute wie Jon Lundberg in Kalifornien und Marc Silber und Matt Umanov in New York spezialisierten sich auf alte Gitarren, lernten, sie zu reparieren und brachten ihre Kunden dazu, sie auszuprobieren.
Trotzdem blieben OMs vorerst nur ein Insider-Thema, und hin und wieder fing Martin an, ganz kleine Serien der Gitarren als Sonderbestellungen zu bauen. So z. B. wurden 1969 sechs OM-28 und 1977 einige OM-45 gebaut. In den späten 70er-Jahren wurden OM-28- und OM-45-Modelle wieder in den Katalog aufgenommen, waren allerdings nicht Teil der regulären Produktion, sondern mussten über den Custom Shop, der 1979 ins Leben gerufen wurde, bestellt werden.
Die 1993 vorgestellte OM-21 war das erste regulär von Martin in Serie hergestellte Orchestra-Modell seit 60 Jahren! Während der 70er- und 80er-Jahre profitierte die Weiterentwicklung der OM durch eine kleine Gruppe individueller Gitarrenbauer, die sich vor allem diesem Instrumenten-Typ widmeten.
Allen voran Nick Kukich, der Mitte der 70er-Jahre anfing, OM-Modelle unter dem Namen Franklin anzubieten. Von Stefan Grossman und später von John Renbourn entdeckt, bekamen Franklins einen ausgezeichneten Ruf und die Gitarren werden bis heute zu hohen Preisen gehandelt. Auch die Santa Cruz Guitar Co. war eine der ersten Firmen, die das OM-Konzept neu aufgriffen.
Der wahrscheinlich wichtigste Beitrag zur modernen OM kam jedoch vom Fingerstyle-Gitarristen und Vintage-Martin-Fan Eric Schoenberg. Als Ragtime-Spezialist hatte Schoenberg die OM als ideales Instrument für sich entdeckt und obwohl er selbst keine Gitarren baute, wurde er zu einem wichtigen Bindeglied, indem er mit verschiedenen Gitarrenbauern und sogar mit Martin zusammenarbeitete, um nicht nur zur historisch korrekten OM zurückzufinden, sondern dieses Design durch neue Ideen aufzufrischen.
Schoenberg gründete Anfang der 80er-Jahre zusammen mit Gitarrenbauer Dana Bourgeois (heute von Dana Bourgeois Guitars) Schoenberg Guitars. Seine Idee war, dass er und Bourgeois die Hölzer aussuchen, sowie bestimmte Abschnitte der Konstruktion durchführen würden und Martin dann den Großteil der Gitarren baut.
Tatsächlich ließ sich Martin auf diese Zusammenarbeit ein, und bis 1994 baute dieses Team (gegen Ende dieser Zeit übernahm TJ Thompson Bourgeois’ Rolle) über 200 Gitarren. Rückblickend kann man sagen, dass Martin durch die Zusammenarbeit mit Schoenberg und Bourgeois resp. Thompson wieder lernte, richtige OMs zu bauen.
Wenn man einen Blick auf das gegenwärtige OM-Angebot wirft, ist es kaum nachvollziehbar, dass dieser Gitarrentyp noch vor 20 oder 30 Jahren kaum zu finden war. Neben den bereits genannten Herstellern gesellte sich auch Collings Guitars zu den angesehenen OM-Experten, und natürlich hat auch Dana Bourgeois seine mit Schoenberg gewonnenen Erfahrungen auf seine heute von seiner eigenen Firma angebotenen OMs übertragen.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche andere Gitarrenbauer die sich auf diesen Instrumenten-Typ spezialisiert haben, wie z. B. Julius Borges, Bruce Sexauer und John Slobod in den USA sowie auch Ralph Bown in England und Stevens Guitars in Deutschland. Neben sündhaft teuren Instrumenten von den Stars der Luthier-Szene gibt es allerdings auch erstaunlich erschwingliche OMs.
So z. B. bieten die E60M von Eastman, die TW40 von Tanglewood und die R-OM-6 von Recording King amtliches OM-Feeling und – Sound für wenig Geld. Ähnlich ist bei Epiphones Masterbilt EF500, die zwar nicht speziell als OM angeboten wird, jedoch fast alle entsprechenden Dimensionen aufweist.

Die OM-21, die Martin 1993 als Serienmodell wieder in den Katalog brachte, wird weiterhin angeboten, und mit ihrem schlichten Design oft für ihr besonders gutes Preis/Leistungs-Verhältnis gepriesen.
Eher traditionelle OMs gibt es in der Standard-Serie (z. B. OM-28, OMC-35E und OM-42) und für Vintage-Fans gibt es Modelle mit Pickups (OM-28 Retro) sowie ganz im alten Stil gebaute Modelle in der Authentic Serie. Bei diesen Instrumenten handelt es sich um extrem originalgetreue Reissues von OM-18-, OM-28- und OM-45-Modellen, die in Sachen Qualität und Preis locker mit Instrumenten der Boutique-Hersteller mithalten können.
Obwohl Fingerstyle-Gitarristen wohl zur größten Fangemeinde gehören (so z. B. spielen Laurence Juber und Jacques Stotzem Signature-Modelle von Martin), sind OMs ungeheuer vielseitig. So z. B. spielen auch Flatpicking-Virtuosen wie James Nash und Sean Watkins auf OMs (von Santa Cruz bzw. Bourgeois), und auch Popstars wie John Mayer und Paul Simon stehen gerne mit OMs auf der Bühne.
Teja Gerken
Die Martin Dreadnought
So schillernd die Geschichte der C.F.-Martin-Company ist, so schillernd ist auch die Geschichte der Dreadnought, der Westerngitarre, die nach einem englischen Schlachtschiff benannt wurde und deren Geburtshelfer ausgerechnet ein fröhlicher Musiker aus Hawaii gewesen war.

Das D-Modell, wie diese große Gitarre intern platzsparend benannt wurde, hat sich im Laufe der Jahre nicht nur etabliert, sondern allen populären musikalischen Genres Amerikas seinen Stempel aufgedrückt.
Von einfachen Hillbilly-Balladen über die String-Bands der 1920er- und -30erJahre, Country & Western, Folk-Rock bis hin zum lauten Rock’n‘Roll war die Martin Dreadnought stets omnipräsent vertreten und hat einen Sound geprägt, der bis heute als Maßstab und Wegweiser gilt.
Kein anderes akustisches Instrument hatte solch einen Einfluss auf die musikalische Entwicklung Amerikas und damit der Welt. Dabei war die Dreadnought alles andere als ein sofortiger Erfolg.
„Die Musiker waren kleinere Instrumente gewohnt“, erzählt der heute CEO Chris Martin IV, „ausgewogener klingende Instrumente, die leicht zu spielen waren.“
Und Dick Boack, der Direktor des Martin-Museums und -Archivs, ergänzt: „Die ersten Dreadnoughts nannte man sogar Bass-Gitarren, weil sie die Bass-Frequenzen ungewohnt laut betonten. Diese großen Gitarren waren insgesamt recht obskure Instrumente, die sich anfangs gar nicht gut verkauften.“
1916 war die Firma schon ca. 80 Jahren aktiv im Business. Die Martin-Gitarren im 19. Jahrhundert hatten noch kleine Bodies, natürlich 12-Bund-Hälse und waren mit Darmsaiten bespannt. Im Laufe der Zeit waren die Korpusse immer größer geworden – ausgehend vom zierlichen Modell 5 entstanden dann die Größen 4, 3, 2, 2 1/2, 2 und 1. Je kleiner die Nummer, desto größer die Gitarre.
Dann gingen ihnen die Zahlen aus, man bemühte die 0, für die nächste Wachstumsphase die 00 und schließlich die 000, die größte Martin in der Ära vor 1916.
Gitarren waren damals nicht gerade angesagt – im Jazz und Vaudeville, der auch in den USA angesagten Form des französischen Revue-Schlagers, spielten sie keine Rolle, weil sie nicht laut genug waren.
Hier und da bei einem Barn Dance als Rhythmus-Instrument neben Fiddle und Banjo, auch mal als Begleitung liederlicher Kneipenlieder und – wegen ihrer Transportabilität – auf so manchem Siedler-Treck gen Westen wurde die Gitarre gesehen, und natürlich in der Black Community, bei den Sklaven, die sich mithilfe der Gitarre ihren Blues von der Seele sangen. Anfang des 20. Jahrhunderts eroberte die Gitarre dann die Salons – in den kundigen Händen vornehmer Damen, die in privaten Runden aufspielten.
Diese Gitarren waren besonders klein, auch um der fraulichen Ergonomie zu entsprechen, und bekamen hier ihren Namen: Parlor-Gitarren (Parlor = Salon).
Der entscheidende Impuls zur Entwicklung größerer Gitarren kam aus Hawaii. Hier bekamen die Amerikaner angeblich zum ersten Mal eine Ukulele zu Gesicht. Aber sie sahen auch, wie ein Hawaiianer eine Gitarre spielte, die mit Stahlsaiten bespannt und anders als sonst („slacked“) gestimmt war.
Die Gitarre lag quer auf dem Schoß des Musikers, der mit einem Stück Metall über die in ordentlichem Abstand über dem Griffbrett verlaufenden Saiten glitt und auf diese Weise Töne und Akkorde spielte – mit einem Sound, der völlig neu war.
Die Hawaiianer nannten diese Gitarre Ki ho‘alu, die Amerikaner schon bald Slack-key Steelstring. Und schon begann der Hawaii-Virus zu grassieren. Bands in Ukulele-, Slide- und normaler Gitarren-Besetzung schossen wie Pilze aus dem Boden, was natürlich auch Martin Guitars nicht verborgen blieb.
Und die Musiker fragten nun nach Stahlsaiten-Gitarren, auch deshalb, weil auf den Banjos mittlerweile Stahl- die alten Darmsaiten abgelöst hatten und diese nun noch lauter tönten als vorher.
Es musste etwas passieren – und dann half das Schicksal mit: Major Kealakai, der Steel-Gitarrist, der auf der Pan-Pacific-Hawaiian-Ausstellung noch für Furore gesorgt hatte, zog nach Chicago um und tourte von dort mit seiner Band Royale Hawaiian Sextette durch die Vaudeville-Clubs der Ostküste.
Natürlich gab es weder Mikrofone noch Verstärker, und der Major suchte nach einer Gitarre, die einfach lauter war als alles andere, was es zu der Zeit gab. So orderte er eine Martin 000, die mit einer Länge von 20″ größte Gitarre, die Martin damals herstellte.
„Aber auch die 000 war ihm nicht laut genug“, erzählt Dick Boack, „und so bestellte er eine weitere Gitarre auf der Basis der 000, aber proportional noch größer.“
Anfang 1916 erfüllte der Martin-Gitarrenbauer John Deichmann mit einer nun 21″ langen Martin Kealakai Dreadnought die Anforderungen des Majors. Die riesige Gitarre hatte ein Fächer-Bracing, ein 4″ großes Schallloch und einen 20-bündigen Hals, über den Stahlsaiten verliefen.
Am 16. März 2016 verschickte Martin diese Gitarre mit der Seriennummer 12210 an Major Kealakai nach Chicago – dies war die erste Dreadnought.

Auf der Grundlage der Kealakai-Gitarre baute Martin später im Jahr 1916 für den großen Musikalien-Händler Ditson in Boston eine normal zu spielende Dreadnought, wenn auch noch mit dem damals traditionellen 12-Fret-Hals. Die allererste 111 Dreadnought, wie Ditson das Modell nannte, wurde am 8. August verschickt, und sechs weitere folgten im Dezember desselben Jahres. Die Dreadnought war auf dem Markt!
Die Idee, diese Gitarre Dreadnought zu nennen, stamme vermutlich von seinem Urgroßvater Frank Henry Martin, meint Chris Martin IV. Denn der sei nicht nur ein Geschichtskenner ersten Grades, sondern besonders von dem englischen Kriegsschiff H.M.S. Dreadnought, das der Martin-Gitarre ihren Namen gab, fasziniert gewesen.
Der Dreadnought-Zug kam zeitgleich mit dem Aufkommen der kommerziellen Country-Musik in den 1930er-Jahren richtig ins Rollen. Radiosendungen und Schellack-Platten verbreiteten mit Macht die neuen Sounds, und die Musik von z. B. der Carter Family und vielen anderen Country-Stars wurde in die gesamte Nation getragen.
Die Grand Ole Opry in Nashville, der Tempel der Country-Musik, strahlte wöchentlich im Radio seine beliebte Show aus und trug wesentlich mit dazu bei, die Musik der Cowboys nun auch salonfähig zu machen. Und mitten drin die Martin Dreadnought, die dank ihres vollen und tiefen Sounds den idealen Rhythmusanker für Sänger und ihre Begleitbands darstellte.
Zu dem Zeitpunkt war aus dem 12-Fret-D-Modell bereits eine Gitarre geworden, die den Halsansatz am 14. Bund hatte. Und das war wichtig, wie Dick Boack sagt:
„Es war die Zeit, als Sänger mit ihrer Gitarre vor einem einzigen Mikrofon standen. Sie brauchten eine Gitarre mit einem satten Sound, der ihre Stimme trug und gleichzeitig in adäquater Lautstärke vom Mikrofon eingefangen werden konnte. So morphte das Martin-000- 12-Fret-Design erst in das 14-FretOM-Modell und dieser 14-Fret-Hals fand schließlich auch seinen Weg auf den Dreadnought-Body.“
Dazu musste dieser etwas gekürzt werden, wodurch die Brücke und das Schallloch etwas Richtung Brücke wanderten. Die ersten Superstars der Country-Szene, Jimmie Rodgers (1897-1933) und Gene Autry (1907-1998) spielten Martin-Gitarren und erweckten im ganzen Land Begehrlichkeiten.
Die 12-Fret Gene Autry Dreadnought, die ebenfalls seinen Namen im Griffbrett trug, war die erste D-45 der Firmengeschichte. Jimmy Rodgers und Gene Autry waren die Eckpfeiler einer neuen Musiker-Szene, die sich ebenfalls einer Martin Dreadnought bediente – Hank Williams, Roy Acuff und viele andere.
Unter ihnen sogar der berühmte Bluegrass-Mandolinist Bill Monroe, der immer eine D-28 zur Hand hatte – für den Fall, dass sein gegenwärtiger Gitarrist selbst keine besaß. Als dann 1954 ein gewisser Elvis Presley Bill Monroes Hit ‚Blue Moon of Kentucky‘ in einen Rock-&-Roll-Song verwandelte, ließ auch er sich vom Martin-Virus anstecken und kaufte eine ganze Reihe der Gitarren aus Nazareth, Pennsylvania, erst eine 000, dann eine D-18 und schließlich seine berühmte, in Leder eingebundene D-28.
Der Folk-Rock der 1960er-Jahre manifestierte die Vormachtstellung der Martin Dreadnought, denn er löste einen regelrechten Boom der Akustik-Gitarre aus, von dem natürlich auch Hersteller wie Guild, Gibson, Yamaha und andere profitierten. Wobei viele der wichtigsten Musiker eben die Martin Dreadnought bevorzugten.
„Das waren oft Musiker“, erinnert sich Chris Martin IV, „die eine Message hatten. Die wollten etwas mitteilen, und anscheinend hatten sie das Gefühl, dass die Dreadnought mit ihrem mächtigen Sound sie dabei gut unterstützen könne.“
Auch in die Pop- und Rock-Musik hielt die Dreadnought Einzug – Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd und andere große Bands spielten u. a. Martin Dreadnoughts. Im Soundtrack der 1980er-Jahren spielte die Akustik-Gitarre generell allerdings keine wichtige Rolle mehr.
Wachgeküsst wurde sie erst durch ein TV-Format, das Live-Konzerte bekannter Künstler in Club-Ambiente mit abgespecktem „unplugged“ Instrumentarium produzierte.
MTV Unplugged startete 1989 und „Strippeddown“-Konzerte von vor allem Eric Clapton, Bryan Adams, Bruce Springsteen, Nirvana, Kiss und vielen anderen transportierten die Akustik-Gitarre wieder in den Focus der Öffentlichkeit. Auf der Unplugged-Welle reitend, verschaffte sich die Singer/Songwriter-Bewegung wieder neue Aufmerksamkeit und ist auch heute noch eine der beliebtesten Musikrichtungen.
Nicht umsonst ist die Dreadnought in ihren vielen verschiedenen Versionen und Preiskategorien immer noch der Verkaufsrenner des Martin-Katalogs. Und nicht nur dort.
Heinz Rebellius
Wenn Du noch mehr über zu AkustikGitarren wissen willst, empfehlen wir das AkustikGitarren ABC in unserem Shop!