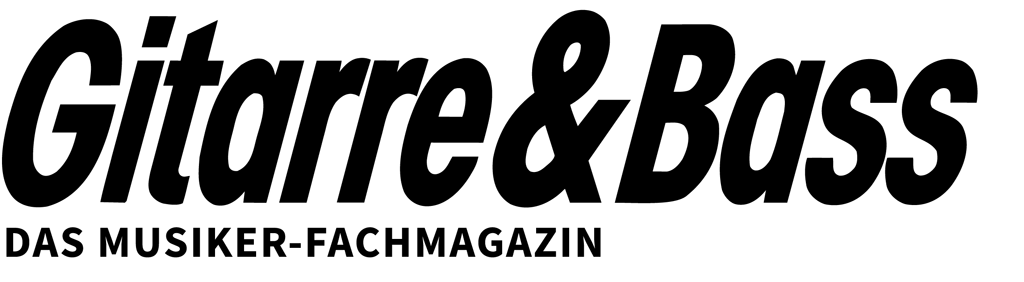Ibanez & die ganz spezielle Beziehung zur DDR
Eisernen Vorhang und die Jugendlichen im Osten ließen sich nur zu gern von dem anstecken, was sie heimlich im West-Radio hörten und später im Fernsehen zu sehen bekamen. Dass die in der DDR bekannteste und meist gespielte West-Gitarrenmarke nun ausgerechnet eine aus dem Fernen Osten, nämlich Ibanez, war, ist die Ironie des Schicksals.

Hinter dem klangvollen Markennamen Ibanez steht das japanische Unternehmen Hoshino Gakki Co., LTD, das u. a. auch Tama-Schlagzeuge herstellt. Es wurde 1908 von Matsujiro Hoshino in Nagoya, ca. 300 km südlich von Tokio, erst als Buchhandel begründet, der bereits ab 1909 jedoch auch Musikinstrumente vertrieb. 1921 begann man mit dem Import europäischer und amerikanischer Musikinstrumente und Ende der 1920er Jahre, auf dem Höhepunkt eines Konzertgitarren-Booms in Japan, entschloss man sich, Gitarren unter einem eigenen Label in Japan produzieren zu lassen. 1929 erschien der spanische Name Ibanez Salvadol erstmals auf Konzert-Gitarren. Während des Zweiten Weltkrieges wurden alle Produktionsstätten zerstört.
Erst 1950 wagte Hoshino den Neuanfang. In den frühen 1960er Jahren begann die Zusammenarbeit mit der amerikanischen Elger Company, die als eine der ersten preiswerte japanische Musikinstrumente auf den US-Markt brachte, ungefähr ab 1967 auch die ersten von Ibanez. Seit 1961 arbeitet Hoshino auch erfolgreich mit dem deutschen Vertrieb Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co. aus Neustadt a. d. Aisch zusammen, der bis heute den Ibanez-Vertrieb inne hat. Bis auf die Tama-Akustik-Gitarren-Manufaktur besaß Hoshino nie eigene Produktionsstätten in Japan. Die Instrumente wurden im Auftrag von den großen Fabriken Fuji Gen Gakki, Kasuga, Chu Sin Gakki u. a. produziert, die auch Instrumente für andere japanische und später amerikanische Marken herstellten. Heute werden Ibanez-Gitarren an verschiedenen Standorten in Japan, Korea, Indonesien und China produziert.
Kopien
Nach einer Reihe von aus heutiger Sicht oft skurril anmutender E-Gitarren-Designs konzentrierte sich Hoshino ab ca. 1968/69 darauf, möglichst exakte Kopien populärer amerikanischer Gitarren produzieren zu lassen. Verkaufsleiter Mike Shimada, seit über 28 Jahren in der Firma, erinnert sich: „Wir wollten Ibanez als erfolgreiche Marke etablieren, das aber war nicht einfach. Wir mussten uns danach richten, was der Markt verlangt. Also bemühten wir uns, die besten Kopien herzustellen.“ Man brachte vor allem Nachbauten der Akustik-Gitarren der Marken Martin, Gibson und Guild sowie der E-Gitarren von Gibson, Fender und Rickenbacker, aber auch einige Exoten, auf den Markt. Zu den ersten Instrumenten dieser Phase zählen eine Stratocaster-Adaption mit zwei (!) P90-artigen Singlecoils mit der Modellnummer 2020, sowie ein baugleicher Jazz-BassVersuch (2030).
Bemerkenswert an diesen frühen Instrumenten ist, dass das alte Ibanez-Logo in der runden „Spaghetti“-Schrift als geprägtes Blechschild auf die Kopfplatte genagelt(!) wurde. Auffällig waren auch die noch recht freien Kopien der Dan-Armstrong/Ampeg-Plexiglas-Gitarre 2364 und des dazugehörigen Basses 2364B. Maßgeblich verantwortlich für die Ibanez-Produktpolitik der Jahre 1973 bis 82 war der früherer Elger-Mitarbeiter Jeff Hasselberger. Unter seiner Anleitung wurde fast die gesamte Bandbreite der Klassiker des modernen amerikanischen Gitarrenbaus kopiert: Akustische Dreadnoughts und Jumbos, sämtliche historische und auch die damals aktuellen Teles, Strats, Les Pauls, SGs, Explorer, Flying Vs, L5S, L6S, Fender-, Gibson-, Höfner- und Rickenbacker-Bässe, Jazz-Gitarren aller Art, selbst Mandolinen- und Banjo-Repliken finden sich in den Prospekten jener Zeit. Sogar die von Gibson vermutlich nie (oder doch 19 mal?) produzierte E-Gitarre Moderne gibt es als äußerst rare Ibanez 2369!
Hoshino ging auch dazu über, einzelne Modelle zu veredeln, z. B. die mit aufwändigen Schnitzereien am Body und Kopf versehenen Artwood-Strats 2408-1 bis 3, die erstmals 1974 in Kleinstserie erschienen. 1975 war der Prospekt auf ca. 85 E-Gitarren und Bässe, darunter allein 20 verschiedene Les-Paul-Modelle (unterschiedliche Farben nicht mitgezählt!), angewachsen. Ab 1976 enthält der Ibanez-Katalog zudem eine riesige Auswahl an Ersatzteilen, Zubehör, Effektgeräten, Verstärkern und Mikrofonen. Vorgestellt werden hier auch frühe Artist-Modelle (erstmals 1974) und die von dem japanischen Hersteller Greco entwickelten Iceman-Vorläufer. Der Vollständigkeit halber erwähnt werden muss die preiswertere Hoshino-Marke Cimar, die einen auf die wesentlichen Modelle reduzierten Katalog anbot, sowie die Edelmarke Tama, die erstklassige handgearbeitete Akustik-Gitarren im Programm hatte. Wegen der sehr hohen Preise – das Spitzenmodell 3563 kostete damals bereits DM 1495 – blieben die Verkaufserfolge jedoch recht gering und die Produktion wurde bald wieder eingestellt.
Der Legende nach soll Hoshino mit den Tama-Akustik-Gitarren, die die Vorläufer der Ibanez Artwood-Serie waren, nur einmal richtig Geld verdient haben: beim Verkauf der Tonholzbestände! Eine eigene Erfolgsgeschichte sind die seit der Mitte der 1970er Jahre weltweit sehr populären Ibanez-Effektgeräte. Hasselberger vermittelte auch eine Reihe bedeutender Gitarristen als Ibanez-Endorser, u. a. Paul Stanley von Kiss, Bob Weir von Grateful Dead und den Jazz-Gitarristen & PopStar Georg Benson. Sogar die grandiosen Brachial-Popper The Slade, eigentlich als Gibson SG-Spieler bekannt, warben für die Rocket Roll 2387 genannte Ibanez Flying V. Und auch Albert Lee, in den 1970ern Mitglied der Emmylou Harris Hot Band, posierte lange Zeit mit einer Ibanez-Mandoline.
Rock-Ost
Wie überall auf der Welt lösten die ersten Beat-Bands mit ihrem Sound und schrillen Outfits schwere ästhetische Irritationen bei der Erwachsenengeneration aus. Die DDR-Führung vermutete hinter dieser Mode anfangs jedoch weit mehr: einen von Geheimdiensten gezielt gesteuerten Angriff der westlichen Massenmedien auf die staatliche Ordnung und ihre Ideologie! Erst Ende der 1960er Jahren setzte man in der DDR staatlicherseits auf eine eigene Rock-Musikszene.

Beim einzigen großen internationalen Jugendfestival in der DDR, den Weltfestspielen in Berlin (1973), sollte den Zehntausenden ausländischen Besuchern natürlich mehr geboten werden als nur Folklore und die politischen Lieder der staatsnahen Singe-Bewegung. Den Bands wurden plötzlich Auftrittsmöglichkeiten in den Medien eingeräumt, die ersten Langspielplatten erschienen. Das Verhältnis zwischen Rock-Bands und Staat aber blieb gespannt. Auftritte wurden überwacht (Liedermacher Kurt Demmler: „… einer ist immer dabei!“), Texte wurden zensiert und um als Amateurmusiker oder Profi auftreten zu können, bedurfte es einer staatlichen Spiel-Erlaubnis.
Diese „Pappe“ legte die Einstufung fest, d. h. die Höhe der von allen Veranstaltern einheitlich zu zahlenden Gage, und wurde bei Missverhalten kassiert, so dass die betroffenen Künstler nur noch in nicht-öffentlichen Veranstaltungen in Kirchen oder Studentenclubs auftreten konnten. Selbst regionale Bands, wie z. B. Rock Virus aus Ludwigslust, waren Opfer aufwändiger Stasi-Intrigen: Nachdem der Versuch, sie mit unkorrekten Abrechnungen oder der Nichteinhaltung des 60:40-Verhältnisses (Bands und DJs sollten höchstens 40% West-Titel spielen!) fehlgeschlagen waren, wurden die Musiker und Techniker der Band bewusst zeitlich versetzt zum Wehrdienst eingezogen, um so die Band zu splitten. Zum Glück ohne Erfolg, denn sie rocken noch immer kerngesund! Diese alltägliche Gängelung führte zu einem ständigen Katz-und-Maus-Spiel um die Beachtung politischer Tabus, das vielen Künstlern zwar Inspiration beim Song-Schreiben war und auch die Glaubwürdigkeit bei den Fans sicherte, dem sie sich aber nach der Biermann-Ausbürgerung 1976 immer häufiger durch Flucht oder Ausreise in den Westen entzogen.
Westware
Eine andere Facette des Rock-Musiker-Daseins in der DDR bestand in der Schwierigkeit, an das notwendige moderne Equipment heranzukommen. Akkordeons, Blasinstrumente, Saiten- und Zupfinstrumente wurden im Musikwinkel des Erzgebirges in großer Zahl und guter Qualität hergestellt. Der dünn gesäte Fachhandel bot diese Erzeugnisse aus Klingenthal und Markneukirchen zu moderaten Preisen an, doch Equipment für die seit den 1960er Jahren entstandene Rock-, Pop- und Folk-Szene war jedoch aus heimischer oder RGW-Produktion (Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, vergleichbar mit der EG) kaum zu bekommen. Besonders Gitarren waren nur „unter dem Ladentresen“ erhältlich, Zubehör wie Saiten, Effektgeräte oder Cases gab es fast gar nicht, heimische Verstärker und E-Gitarren kamen erst kurz vor dem Ende der DDR in messbaren Stückzahlen in die Läden.
Allerdings waren diese Stratocaster- und Jazz-Bass-Kopien wegen ihres klobigen Handlings verpönt. Ein gewisses Prestige hatten allenfalls einige handgefertigte Jazz- und Akustik-Gitarren aus kleinen privaten Familienbetrieben (z. B. Lederer). So hatten die West-Gitarren in der DDR nicht nur aufgrund ihrer Qualität, sondern auch wegen ihrer Unerreichbarkeit einen uneinholbaren Nimbus. Die großen amerikanischen Markennamen waren jedem Gitarrenanfänger geläufig, auch wenn die Vielzahl der einzelnen Modelle und die z. T. erheblichen Preisunterschiede meist unbekannt waren. Nach Fender und Gibson war Ibanez sicher die bekannteste und am weitesten verbreite WestGitarrenmarke in der DDR: Anfangs wegen ihrer guten und preiswerten Kopien der amerikanischer Gitarren, später auch wegen ihrer Eigenentwicklungen, wie z. B. Artist, Musician oder Roadstar.
Die wohl angenehmste Art und Weise an sein professionelles Handwerkzeug zu gelangen, bestand darin, einfach ein paar gut dotierte Gigs im Westen zu absolvieren, um die spielend erworbenen DM gleich an Ort und Stelle im reichlich bestückten Fachhandel auf den Kopf zu hauen. Uwe Hassbecker von Silly ist dieses höchst seltene Glück als 17-jährigem (!) Mitglied der Uschi-Brüning-Band tatsächlich widerfahren – eine Ibanez Les Paul Custom 2650CS war seine Beute. Der Kreis der Bands, die diese Möglichkeit hatten, blieb bis zum 9. November 1989 allerdings im wahrsten Sinne des Wortes begrenzt. Übrigens bestand für DDR-Künstler, die im Westen touren durften, ein ganz besonderer Zwangsumtausch: Sie mussten bei ihrer Rückkehr die Hälfte ihrer oft nicht sehr üppigen DM-Gage in Mark der DDR zurücktauschen!
Sammeln
In der DDR der späten 70er war Ibanez für viele fast so etwas wie das Synonym für „West-Gitarre“ und entsprechend heiß begehrt. Nur wenige Spitzen-Bands besaßen die amerikanischen Originale und auch sie hatten zu Beginn ihrer Karriere fast ausnahmslos Ibanez-Kopien gespielt, wie meine Recherchen zur „Ibanez Guitar Stories“-Ausstellung im Technischen Landesmuseum Schwerin ergab. Die riesige Ibanez-Produktvielfalt war zwar weitestgehend unbekannt, da Prospekte oder Musikermagazine nicht zur Verfügung standen. Aber im Kollegenkreis gab es schon damals ein paar Strats, Teles sowie einen Rickenbacker- 4001-Nachbau von Ibanez. Auch meine erste „West-Gitarre“ war eine Ibanez: eine Akustik-Gitarre aus der Concord-Serie, Modellnummer 647, Baujahr 1975.

Die 647 ist eine recht häufig verkaufte Kopie einer Fender King Flat Top aus dem Jahr 1969: Eine Dreadnought mit einer Stratocaster-Kopfplatte – für mich damals einfach ein Traum! Ich war Student der Uni Rostock und kaufte die Concord gebraucht für 2000 Mark der DDR von einem ungarischen Kommilitonen – eine Menge Geld für damalige Verhältnisse, denn das Monatsgehalt eines jungen Diplom-Ingenieurs lag bei 700 Mark. Dennoch, ich war glücklich und sie hat mich auf hunderten von Gigs mit meiner Band Canguru begleitet, ich habe viele Songs auf ihr geschrieben und spiele sie heute noch. Nach dem Fall der Mauer kam die deutsche Wiedervereinigung und mit ihr die D-Mark.
Der in der DDR entstandene Heißhunger auf Produkte der großen amerikanischen und englischen Hersteller wurde exzessiv ausgelebt, Markengläubigkeit war erste Bürgerpflicht! Später, 1996, suchte ich aus Anlass der Gründung unserer Familien-Band für meinen Sohn eine Anfänger-Bassgitarre. Von einem Kollegen kaufte ich eine gebrauchte Jazz-Bass-Kopie von Ibanez, Modellnummer 2365B ohne Seriennummer, auf dem sich später Noel Redding, der legendäre Bassist der Jimi Hendrix Experience, mit seinem Autogramm verewigt hat! So entstand in mir der Gedanke, Ibanez-Kopien der klassischen amerikanischen Rock- und Folk-Instrumente zu sammeln.
Zu fast jedem dieser Gitarrenmodelle hatte und habe ich Assoziationen und Erinnerungen: an einen Gitarrenhelden, eine Platte oder an ein denkwürdiges Konzert. Als ich 1997 im Hamburger Nr.1 Music Park bei Thomas Weilbier eine modifizierte SG, Modellnummer 2354S ohne Seriennummer erstand, war meine Sammlerleidenschaft endgültig geweckt. Ich wollte möglichst viele verschiedene Gitarrenklassiker mit dem alten Ibanez-Logo auf der Kopfplatte!
Zahlenspiele
Während der Kopierphase waren Ibanez-Instrumente fast durchgängig mit Modellnummern bezeichnet. Echte Namen bekamen einzelne Highlights des Programms erst ab ca. 1975, wie z. B. die berühmte Custom Agent Scroll Les Paul 2405, der Black Eagle Jazz Bass 2609B oder die Destroyer Explorer 2359. Seriennummern erhielten Ibanez-Instrumente erst ab1975. Sie bestanden anfangs aus einem großen Buchstaben und einer sechsstelligen Zahl. Der Buchstabe bezeichnete den Monat und die ersten beiden Ziffern das Jahr der Herstellung. Die Nummer D 773509 steht demnach für eine im April 1977 hergestellte Gitarre, die vier letzten Ziffern sind die laufende Nummer der in dem jeweiligen Monat hergestellten Instrumente.
Bei den Akustik-Gitarren der Concord-Serie, deren Seriennummer am Halsstock aufgestempelt ist, fehlte 1975 noch der Buchstabe. Die Datierung der früheren Baujahre ist einigermaßen sicher anhand leichter Variationen des Logos bzw. der „Made in Japan“-Prägung und anhand der verwendeten Hardware möglich. Richtig knifflig wird die Sache allerdings bei den sehr frühen Kopien, die ganz ohne Ibanez-Logo ausgeliefert wurden! Neben der enormen Bandbreite des Angebotes war sicher das insgesamt sehr gute Preis/Leistungsverhältnis Voraussetzung für den großen Markterfolg von Ibanez. Dabei war preiswert (ca. ein bis zwei Drittel der Preise der Originale) nicht immer mit „billig“ gleichzusetzen: Die Listenpreise einer Les-Paul-Kopie bewegten sich z. B. 1976 zwischen DM 638 für eine schwarze Custom 2350 mit geschraubtem Hals und DM 1090 für eine Custom 2650 mit geleimtem Hals.
Eine einfache Konzertgitarre 2851 war für DM 324 zu haben, die Concord-Akustik-Gitarren kosteten zwischen DM 375 und DM 800. Eine handgearbeitete Mandoline wie die 524CW stand mit immerhin DM 1250 zu Buche. Die Jazz-Gitarren bewegten sich zwischen DM 800 und DM 1490. Absolute Spitze war im November 1976 das Doppelhalsmodell 2670, für das sagenhafte DM 3300 aufgerufen wurden. Die erhebliche Preisdifferenz zu den kopierten Originalen hatte ihre Ursache nicht nur in den unterschiedlichen Lohnniveaus in Japan und den USA. Denn während die äußere Erscheinung der Originalinstrumente von Ibanez meist sehr genau kopiert wurde, gab es zumindest bei den preiswerten Modellen sowohl bei den Tonhölzern als auch bei der verwendeten Hardware merkliche Qualitätsunterschiede. Dafür war die Verarbeitungsqualität, gerade auch im Vergleich zu den Marktführern, in der Regel sehr gut.
Die Ähnlichkeit der Instrumente war so groß, dass 1977 in einer Anzeige eines großen Musikgeschäftes Ibanez-Instrumente statt der beworbenen Gibsons abgebildet waren. Nicht nur für Preis- und Baujahr-Recherchen empfehle ich einen Blick auf die großartige Homepage www.ibanez-vintage-page.de von Hasy Neuenschwander aus der Schweiz und Harry Kruisselbrink aus den Niederlanden. Hier gibt es eine fast vollständige Kollektion der Prospekte mit den dazugehörigen Preislisten und eine Vielzahl weiterer Infos über Ibanez-Kopien amerikanischer Instrumente.
Lawsuit
Immer wieder wird der berühmte Lawsuit (engl., Rechtsstreit) zwischen Gibson und Ibanez bemüht, wenn es um alte Ibanez-Instrumente geht. Dabei eignet sich diese für den internationalen Musikalienhandel sicher wichtige Zäsur keineswegs für die Bestimmung der Qualität eines Ibanez-Modells, wie das vielleicht im Falle Fender beim Besitzerwechsel zu CBS zutrifft. Der entscheidende Unterschied zwischen den Instrumenten des 1975er Pre-Lawsuit-Kataloges zu denen des Jahres 1976 besteht allein in der nach dem Vorbild der Guild-Kopfplatte veränderten Form des Headstocks bei den Gibson-Kopien.
Maßgebliche Veränderungen der sonstigen Form, der technischen Ausstattung oder gar der Verarbeitungsqualität finden sich nicht. Vielmehr waren einige Bauteile wie die Pickups und Mechaniken bei den sehr frühen Kopien manchmal von eher bescheidener Qualität und wurden zum Leidwesen der heutigen Sammler entsprechend oft ausgewechselt. Bei den Kopien anderer Marken oder bei den Gibson-Gitarren mit einer anderen als der typischen Les Paul/SG-Kopfplatte gab es überhaupt keine Veränderungen. Fender-Kopien z. B. wurden bis 1978, zuletzt in der sehr guten Silver Series, unverändert weitergebaut.

Die historischen Abläufe des Rechtstreits sind heute nur schwer zu rekonstruieren. Hier eine kurze Zusammenfassung, die sich an die Darstellung aus dem leider vergriffenen Buch „Guitar Stories. The Histories of Cool Guitars“ (ISBN 1-884883-03-6) von Michael Wright anlehnt und die von Hoshino-Mitarbeitern als zutreffend bestätigt wird: Die Ibanez-Kopien verkauften sich Mitte der 1970er Jahre in den USA und in Europa sehr gut, denn sie waren deutlich preisgünstiger als die Originale. Norlin, der Mutterkonzern der Traditionsmarke Gibson, war ziemlich verärgert über diesen Erfolg und drohte Elger, der amerikanischen Vertretung von Hoshino, mit einer Klage.
Man entschloss sich, die Form der Kopfplatte als schützenswertes Detail zum Gegenstand der Auseinandersetzung zu machen, weil der Headstock als markeneigenes Design einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Im Juni 1977 wurde ein Verfahren eröffnet. Im Kern ging es um die Frage, wie weit markenrechtlicher Schutz beim Kopieren von Gitarren-Designs besteht und auf welche Bauteile er sich bezieht. Norlin beabsichtigte, eine gerichtliche Verfügung gegen Hoshino zu erwirken. Diese sollte während der Musikmesse von Atlanta 1977 wirksam werden und verhindern, dass die Ibanez-Gitarren mit Gibson-Kopfplatten gezeigt werden konnten. Aber: Seit 1976 arbeitete Jeff Hasselberger sowieso schon an eigenen Designs.
Diese neuen Ibanez-Gitarren waren bereits für Atlanta eingeplant, so dass 1977 gar keine Gibson-Kopien konfisziert werden konnten. Der Schlag, zu dem Norlin ausgeholt hatte, traf also ins Leere. Hätte Norlin ein Jahr früher prozessiert, hätte das für Ibanez jedoch in einem Desaster enden können. So wurde Anfang 1978 der Streit mit einem außergerichtlichen Vergleich beigelegt. Ibanez sicherte zu, zukünftig auf das Kopieren von Gibson-Modellen zu verzichten. Noch einmal Mike Shimada: „Letztendlich war das alles gut für uns. Mit dem Rechtsstreit gaben sie uns den Anstoß, vorwärts zu gehen und zu begreifen, dass wir unsere eigenen Produkte entwickeln mussten.“ So wurde aus einer für Hoshino im ersten Moment sicher unangenehmen Situation ein positiver Impuls, ohne den es Ibanez in der heutigen Form sicher nicht geben würde.“