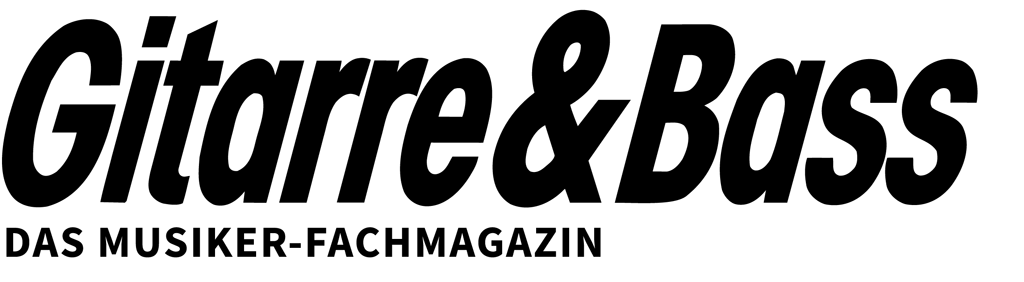Porcupine Tree: Die Bekenntnisse des Steven Wilson
 (Bild: Alex Lake)
(Bild: Alex Lake)
Steven Wilson gilt als Multi-Talent: Ausnahmegitarrist, Studio-Tüftler, Songwriting-Genie und Workaholic. Bei einem Teil dieser Zuschreibungen scheint es sich jedoch um grandiose Fehleinschätzungen zu handeln. Anlässlich von ‚Closure/Continuation‘, dem ersten Porcupine-Tree-Album seit zwölf Jahren, stimmt der bleiche Brite nämlich das Hohelied der Bescheidenheit an: Er sei längst nicht das, was die Musikwelt in ihm sehe. Wer der 54-Jährige wirklich ist, wo seine Stärken und Schwächen liegen und was ihn zum Comeback seiner Band bewegt, verrät er im Gespräch mit GITARRE & BASS.
Timing ist alles: Steven Wilson sitzt müde und erschöpft in einem Konferenzraum seiner Berliner Plattenfirma. Es ist das Ende eines zweitägigen Interview-Marathons, bei dem er sich immer wieder aufs Neue rechtfertigen muss: Für das Comeback einer Band, die er 2010 frustriert auf Eis gelegt hat, weil er sich in der kreativen Sackgasse wähnte. Von der er sich anschließend zwölf Jahre lang verbal distanzierte, und die er nun – wegen Corona-Langweile und ausgebremster Solo-Karriere – reformiert. Dass er damit durchkommt, liegt einzig und allein an der bemerkenswerten Qualität des Materials:
‚Closure/Continuation‘, das elfte Werk der Stachelschweinbande um Wilson, Keyboarder Richard Barbieri und Drummer Gavin Harrison, ist ein kleines Meisterwerk im Spannungsfeld zwischen Progressive Rock, Metal und Alternative Rock. Ein Werk, das den Mythos, der sich während der extensiven Auszeit um das Gespann gebildet hat, tatsächlich rechtfertigt, zum internationalen Bestseller werden dürfte und im Herbst – im Rahmen einer kurzen Europa-Tour – auch auf die Bühne gebracht wird. Der späte Triumph eines Spaßprojekts, das kommerzielle Realität geworden ist, das Wilson – trotz aller Bemühungen – nie losgelassen hat, und über das es viel Interessantes zu sagen gibt.
Steven, warum eine Porcupine-Tree-Reunion nach geschlagenen 12 Jahren und obwohl du sie stets kategorisch ausgeschlossen hast?
Ich bin halt ein guter Lügner. Ich habe den Leuten zwölf Jahre lang erzählt, dass es Porcupine Tree nicht mehr gibt, und irgendwann haben sie es tatsächlich geglaubt. Dabei haben wir die ganze Zeit an neuem Material gearbeitet. Doch das konnte ich ja nicht zugeben, ehe ich wusste, ob daraus wirklich etwas wird. Beziehungsweise wenn ich gleichzeitig Solo-Alben am Start habe, auf die ich den Fokus lenken möchte.
Was lässt dich zum Progressive Rock zurückkehren, wenn du als Solist alles getan hast, um dich davon zu distanzieren?
Weil das keine bewusste Sache war. Ich hatte nie vor, Progressive Rock zu machen, sondern ich höre schon mein ganzes Leben lang die unterschiedlichsten Arten von Musik. Deshalb war ich auch nie sonderlich glücklich mit der Idee, dass Porcupine Tree oder Steven Wilson solo vielleicht für irgendetwas Allgemeingültiges stehen – etwas, das in eine gängige Schublade passt, wie etwa Progressive Rock.
Wobei ich gleichzeitig zumindest ein Merkmal davon mag – nämlich die Idee, da spannende Hybride zu kreieren, indem man unterschiedliche Musik miteinander kombiniert. Das ist eine Tradition, die bis in die 70er zurückreicht, als Bands klassische Musik mit Rock oder auch Jazz mit Rock, Folk mit Rock, usw. vermischt haben. Für mich ist das eines der Merkmale von progressiver Rockmusik – diese Nichtbeachtung von starren Genregrenzen. Das habe ich immer geliebt, und von daher bin ich eigentlich auch ganz froh, mit diesem Album wieder mehr in die Richtung zu gehen. Zumal ich mich in den letzten Jahren ziemlich weit davon entfernt hatte. Das stimmt.
Also schließt du quasi Frieden mit der Vergangenheit?
Ich habe ja nichts gegen das Genre. Mehr noch: Ich mag viel von dem, was die Leute als Progressive Rock bezeichnen – keine Frage. Aber: Ich denke, dass ich es mir an diesem Punkt in meiner Karriere auch verdient habe, als jemand erachtet zu werden, der sich sein eigenes musikalisches Universum erschaffen hat und der schon lange keine allgemeingültige Musik mehr macht. Wobei eine Hälfte von mir gerne zugibt, dass alles, was ich je getan habe, natürlich auf der Tradition der konzeptionellen Rock-Musik, gerne auch des progressiven Rocks, beruht.
Gleichzeitig sind die Künstler, die ich immer am meisten bewundert habe, Bowie, Neil Young, Frank Zappa oder Kate Bush, die jede Art von musikalischem Genre ganz locker gesprengt haben. Ich schätze, niemand käme auf die Idee, Bowie oder Neil Young in einer bestimmten Schublade abzulegen – weil das unmöglich wäre. Denn wie sollte man auch beschreiben, was Kate Bush macht? Das geht nicht – sie macht Kate-Bush-Musik. Oder welche Art von Musik macht Neil Young? Für mich macht er Neil-Young-Musik. Und die beinhaltet auch mal ein Country-, ein Grunge- oder ein Elektronik-Album.
Das ist die Art von Künstler, die ich immer am meisten bewundert habe. Nicht, dass ich mich mit ihnen vergleichen würde, aber ich sage halt gerne von mir, dass ich etwas Ähnliches erreicht habe – in meiner eigenen, kleinen Welt. Deshalb wehre ich mich gegen Schubladen.
OK, und was verwendest du auf den neuen Songs – was Gitarren, Amps, Effekte betrifft?
(lacht) Die Frage habe ich befürchtet. Ganz ehrlich: Ich habe ein Problem damit – schon immer gehabt …
Inwiefern?
Weil ich ein Idiot bin. Und was ich damit meine, ist: Ich gehe meine Musik und mein Gitarrenspiel auf eine Art und Weise an, bei der die meisten Leser wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Denn meine Mentalität und mein Ansatz sind: Es ist mir vollkommen egal, welche Pickups ich verwende, welche Saiten ich aufziehe oder zu welchem Plektrum ich greife – mir geht es nur darum, welche Sounds ich aus einer Gitarre herausholen kann.
Und ich bin völlig aufgeschmissen, wenn mich Musikmagazine mit Fragen konfrontieren wie: „Aus welchem Holz ist der Hals deiner Telecaster?“ Da kann ich nur sagen: „Ich habe keinen blassen Schimmer!“ Und wenn mir das tatsächlich mal jemand erklärt haben sollte, habe ich es sofort wieder vergessen, weil ich es nicht interessant finde. Das gilt auch für: „Welche Pickups benutzt du?“ – „Kann ich nicht sagen. Ich weiß es schlichtweg nicht.“ – „Was für Saiten hast du aufgezogen?“ – „Die, die ich umsonst bekomme!“
Das meinst du nicht ernst …
Doch! (kichert) Und was ich damit sagen will: Ich bin meine Musik schon immer eher aus der Perspektive eines Songwriters angegangen statt aus der eines Musikers. Meine Instrumente dienen lediglich dazu, um Sounds zu kreieren, die ich für meine Kompositionen brauche. Das ist alles. Ich weiß, dass eine Menge sogenannter „echter Musiker“ bzw. Gitarristen eine enge Beziehung, wenn nicht sogar eine regelrechte Liebesbeziehung, zu ihren Instrumenten haben. Doch mir ist es völlig egal, was ich spiele – solange ich das gewünschte Resultat erziele. Natürlich übertreibe ich jetzt ein bisschen, um meiner Aussage Nachdruck zu verleihen.
Klar, liebe ich meine Telecaster – sie sieht sexy und cool aus. Ich habe eine ‘63er Fender Tele, die einfach wunderschön ist. Aber ich könnte beim besten Willen nicht sagen, aus welchem Holz sie gemacht ist. Aber scheiß drauf: Sie sieht gut aus und klingt sogar noch besser. Das ist alles, was zählt. Und ich komme mir geradezu dumm vor, wenn ich darüber sprechen soll. Einfach, weil ich weiß, wie wichtig und wie faszinierend das für Leute ist, die Gitarren-Magazine lesen. Ich habe oft keine Ahnung, was ich da sagen soll. Sorry …
Aber ist es nicht auch ein tolles Kompliment, als solche Koryphäe bzw. Genie verehrt zu werden? Schmeichelt dir diese Fehleinschätzung – wenn es eine ist – nicht auch ein bisschen?
Natürlich schmeichelt es mir, dass jemand denkt, ich wüsste, was ich da tue. Aber ich muss ehrlich sagen: das ist leider nicht der Fall. Ich habe keinen blassen Schimmer. Was auch wieder ein bisschen übertrieben ist: Ich weiß schon, was ich tun muss, um den Sound zu erzielen, der mir vorschwebt – ich mache das schließlich schon länger und habe so oft diesen Prozess des Ausprobierens und Herumtüftelns durchlaufen, dass ich instinktiv spüre, was gut klingt und was nicht. Genau den Ansatz verfolge ich beim Aufnehmen und Mixen meiner Alben und bei allem, was ich mache.
Wobei ich nie eine entsprechende Ausbildung hatte, aber ich habe mir trotzdem einen Namen damit gemacht, klassische Rock-Alben zu remixen und gute Klangergebnisse in Bezug auf alte wie neue Musik zu erzielen. Einfach, weil ich immer genau hingehört habe, weil ich neugierig war und alle erdenklichen Arten von Musik mit offenem Geist angegangen bin. Allerdings fällt es mir immer noch schwer, exakt zu beschreiben, was ich da tue.
Wobei ich auch sagen muss: Wenn jemand ein Instrument spielt oder Platten produziert und mischt, aber eben nicht in der Lage ist, die Musik in seinem Kopf zu hören oder sie sich in seiner Fantasie auszumalen, dann verschwendet er seine Zeit. Denn man sollte es immer zuerst in seinem Kopf hören. Und das sage ich, weil ich über die Jahre verstanden habe, dass es da draußen viele Leute gibt, die in Sachen Studioarbeit viel besser ausgebildet sind, als ich, und die auch bessere Gitarristen sind und als Techniker eindeutig mehr auf dem Kasten haben. Aber: Ihre Musik klingt trotzdem nicht so gut, wie meine, und das liegt allein daran, weil sie sie nicht in ihrem Kopf hören.
 (Bild: Adam Taylor)
(Bild: Adam Taylor)
Im Stück ‚Of The New Day‘ klingst du eher wie Pavement – mit einem schrammeligen, disharmonischen Sound …
Das Witzige ist: Den Song habe ich ursprünglich für mein nächstes Solo-Album geschrieben, mit dem ich etwa zur Hälfte fertig bin. Die erste Version ist auf dem Klavier entstanden, das in meinem Studio steht und sich immer wieder verstimmt. Das geht so weit, dass es nach sechs Monaten eigentlich nicht mehr zu verwenden ist. Trotzdem habe ich die Nummer kurz vor einem Stimmtermin geschrieben, weshalb sie ziemlich schräg klang. Aber als das Klavier dann frisch gestimmt war und ich den Part neu und sauber einspielen wollte, wurde mir klar: „Auf diese Weise hat es nicht ansatzweise so viel Charakter wie die ursprüngliche Fassung.“ Also habe ich die verstimmte Version behalten.
Und solche Sachen passieren im Grunde ständig: Führt man sich die Geschichte der Musik vor Augen, sind es oft die Fehltritte und kleinen Unzulänglichkeiten, die einem Stück Stärke und Persönlichkeit verleihen. Genau das vermisse ich in der modernen Popmusik, die so sauber und durchgestylt ist: Da fehlt einfach das gewisse Etwas. Und das liegt daran, dass junge Leute meinen, dass sei eben die Art, wie Popmusik klingen sollte – weil ihnen die Industrie das so eingetrichtert hat. Sie denken ernsthaft, die menschliche Stimme würde am natürlichsten klingen, wenn man sie mit Autotune nachbehandelt – weil es das Einzige ist, was sie je gehört haben.
Konfrontiert man sie dann mit Aretha Franklin, Robert Plant oder Morrissey, die auch mal ein bisschen daneben liegen, sind sie der Meinung, das wäre merkwürdig und falsch. Dabei ist das der natürliche Klang einer Stimme. Um aber noch mal auf das Porcupine-Tree-Album zurückzukommen: Ich spiele diesmal übrigens vor allem Bass.
Wie kommt‘s?
Ganz einfach: Ich mache das wahnsinnig gerne. Es war am Anfang des Entstehungsprozesses, als Gavin und ich einen Heidenspaß hatten, bei spontanen Jams funkige Grooves und ungewöhnliche Polyrhythmen zu kreieren. Was wohl damit einherging, dass ich immer weniger Gefallen an der Gitarre hatte. Weil ich anfing, mich zu wiederholen und mit nichts wirklich Neuem aufwarten konnte. Doch sobald du dann zu etwas anderem greifst, wie einem Bass oder einem Synthesizer, ist da plötzlich dieses ganze Zeug, an dem du dich noch nie zuvor versucht hast. Und das ist eine wunderbare Sache – nach dem Motto: „Ich habe mein Repertoire doch noch nicht vollends ausgereizt.“ Während ich bei der Gitarre sehr wohl das Gefühl hatte, als hätte ich da alles getan – zumindest alles, was ich mit meinem eingeschränkten Talent hinkriege. Das war wohl der Hauptgrund für diese Entscheidung.
Wie geht es mit Porcupine Tree weiter? Oder seid ihr euch da – wie der Albumtitel ‚Closure/Continuation‘ andeutet – gar nicht so sicher?
Genau das ist es, was der Titel zum Ausdruck bringt: Wir wissen es nicht. Aber ich finde, es ist ein tolles Album und es beinhaltet alles, wofür Porcupine Tree steht. Insofern ist es vielleicht der Auftakt zu mehr – zu einem produktiveren Arbeiten. Vielleicht brauchen wir beim nächsten Mal ja nur sieben Jahre statt zwölf. (lacht) Ich weiß es nicht. Aber Richard und ich reden schon über ein weiteres Studio-Projekt. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass wir in Zukunft – nach der nun anstehenden Tour – nochmal auf Tour gehen werden, aber weitere Musik halte ich durchaus für möglich.
(erschienen in Gitarre & Bass 08/2022)