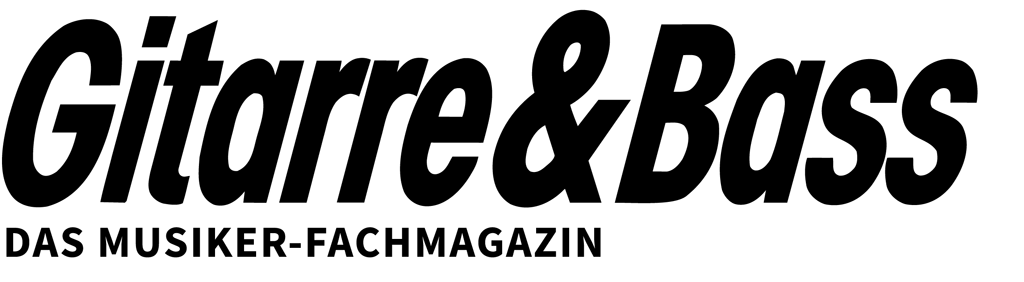Bonnie Raitt: The Queen Of Slide
 (Bild: Marina Chavez)
(Bild: Marina Chavez)
Das Jahr 2022 scheint für die kleine, rothaarige Frau aus Los Angeles ein ganz besonderes zu werden: Anfang April wurde ihr ein Grammy fürs Lebenswerk verliehen – jetzt veröffentlicht sie ihr erstes Album seit 2016: ‚Just Like That …‘, das sich als eines ihrer stärksten erweist. Wie es dazu gekommen ist, was dahintersteckt und wann wir sie wieder in unseren Breitengraden erleben werden, verrät uns die Slide-Queen im Exklusiv-Interview.
Das 18. Werk der mittlerweile 72-jährigen Kalifornierin ist auch deswegen so gut und stimmig geworden, weil sie sich aufgrund der weltweiten Pandemie besser und mit mehr Ruhe darauf vorbereiten konnte als auf viele seiner Vorgänger. Und so ist ‚Just Like That…‘ fast zwangsläufig eines ihrer besten Alben geworden. Sei es nun wegen starker Fremdkomposition aus der Feder von Al Anderson (NRBQ) oder Frederick Hibbert (Toots & The Maytals), aber auch eigenen Stücken, bei denen Bonnie als Instrumentalistin wie Sängerin glänzt und sich an einer imposanten stilistischen Bandbreite von Blues über Country und Rock bis hin zu unvermeidlichen Balladen abarbeitet.
Inhaltlich geht es um den Verlust alter Freunde, die ewige Suche nach Liebe und Glück, aber auch komplexe Themen wie Sterbehilfe in US-Gefängnissen. Alles vorgetragen mit einer Power und Spielfreunde, die geradezu ansteckend ist. Eben kein routiniertes Spätwerk von müden Altmeistern, sondern leidenschaftlich, mit Ecken und Kanten. Den Rest erklärt uns die Dame, die Inga Rumpf und Peter Urban grüßen lässt, ganz einfach selbst.
Bonnie, dein letztes Album liegt sechs Jahre zurück – warum die lange Pause?
Zunächst einmal war ich fast zwei Jahre auf Tour. Anschließend hat mich mein Freund James Taylor gefragt, ob ich nicht mit ihm losziehen wolle, was ich nur zu gerne getan habe. Wir wollten das sogar bis 2020 ausdehnen – ehe uns Covid einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir haben die ausgefallene Kanada-Tour drei Mal angesetzt und wieder verschoben. Was auch bedeutete, dass ich Zeit hatte, um Songs für Organisationen aufzunehmen, die etwas gegen Trump, die Polizeigewalt und den Klimawandel tun. Denn Amerika braucht den Wandel – und viele Menschen und gemeinnützige Organisationen benötigen Hilfe. Da tue ich, was ich kann – und insofern war ich in den letzten zwei Jahren extrem beschäftigt. Das hat mir über vieles hinweggeholfen…
Auf ‚Just Like That …‘ finden sich etliche Fremdkompositionen. Warum schreibst du so wenige Stücke selbst?
Weil das mittlerweile mein 18. Studio-Album ist und ich im Grunde alles gesagt habe, was man zu klassischen Blues-Themen wie Liebe, Herzschmerz, Wut oder Betrug sagen kann. Insofern fällt es mir schwer, da neue Ansätze zu finden oder das aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten als den, den ich bereits verwendet habe. Deshalb suche ich ständig gute Songs, die ich in meine Show und für meine Platten verwenden kann, und die ein bisschen anders sind als das, was ich bereits gemacht habe. Denn: Ich würde mich langweilen, wenn ich nur meine eigenen Songs spielen müsste. Es macht viel mehr Spaß, gute Cover aufzugreifen. Und so handhabe ich es seit Beginn meiner Karriere – seit 1970.
 (Bild: Susan J. Weiand)
(Bild: Susan J. Weiand)
Wie kommt es, dass George Marinelli, der dich drei Dekaden begleitet hat, nicht mehr Lead-Gitarrist deiner Band ist?
Stellt euch vor: Er wollte in Rente gehen und endlich mehr Zeit mit seiner Frau verbringen als immer nur mit der Band. (lacht) Aber er war ja auch 50 Jahre lang auf Tour – und das quasi nonstop. Zum Glück hat er sich zumindest dazu überreden lassen, im Studio vorbeizuschauen und bei den beiden Stücken mitzuwirken, die wir noch gemeinsam für dieses Album geschrieben hatten. Das hat ihm dann so gut gefallen, dass er auch bei der kommenden Tour für zwei oder drei Wochen am Stück mitmischen will. Wogegen ich nichts einzuwenden habe – wir haben dann drei Gitarristen: George, Duke Levine und ich.
Aber sein Ausstieg ist schon ein ziemlicher Verlust, und es sind große Schuhe, die es da zu füllen gilt. Denn nachdem wir jetzt so lange zusammenspielen, ist es fast unmöglich, ihn zu ersetzen. Er ist ein Wahnsinns-Gitarrist, der auch tolle Solo-Alben aufnimmt und den ich als echten Freund sehe. Aber er hat halt genug von dem Lifestyle.
Warum ist nicht Kenny Greenberg sein Ersatz?
Kenny hat zwar auf dem Album gespielt, ist aber ein vielbeschäftigter Produzent in Nashville. Deshalb habe ich Duke gefragt, diesen legendären Gitarristen, der hohes Ansehen in Musikerkreisen genießt und oft mit Peter Wolf von der ehemaligen J. Geils Band auftritt. Er lebt in Boston, genau wie mein Bassist. Die beiden kennen sich ewig, und als ich Duke fragte, ob er für George übernehmen wolle, sagte er sofort zu.
Schon bei den Proben war er unglaublich gut. Er hat einen ganz anderen Stil, kriegt die Parts von George aber perfekt hin und fügt ihnen auch etwas Eigenes hinzu. Als George dann meinte, er würde vorbeischauen, um zu sehen, was wir so machen und ob alles smooth läuft, meinte ich erst: „Lass gut sein – ich glaube nicht, dass da Platz für drei Gitarren ist.“
Doch als wir zusammen gejammt haben, passte das wunderbar – einfach, weil George auf den alten Alben oft mehrere Parts übernommen hatte, die wir live nie umsetzen konnten, weil wir dafür einen weiteren Gitarristen gebraucht hätten. Und dadurch, dass wir zu dritt waren, konnte ich mich einfach aufs Slide-Spielen und Singen konzentrieren. Darauf, mich ganz den Rhythmus-Parts zu widmen, Spaß zu haben und den Jungs zuzusehen. Das war wirklich etwas Besonderes.
Was verwendest du auf den neuen Songs – in Bezug auf Amps, Effekte und Gitarren? Wieder deine legendäre Fender Stratocaster, die Brownie?
Zunächst einmal muss ich sagen, dass dieser Name von meiner Crew stammt – nicht von mir. Sie haben ihn der Gitarre verpasst, um sicherzustellen, dass sie auch das richtige Modell für die Bühne am Start haben – und nicht meine blaue Strat. Die braune spiele ich halt am liebsten, auch wenn ich mittlerweile noch ein paar andere Gitarren dabeihabe, die allein deshalb einen etwas anderen Sound aufweisen, weil sie halt neuer sind. Ansonsten haben sie ähnliche Texas-Special- oder Seymour-Duncan-Pickups.
Ich spiele durch einen Bad-Cat-Amp, einen Röhren-Verstärker, den ich bereits seit Jahren verwende. Dazu kommt ein Kompressor und manchmal noch ein Boost-Pedal für meine Soli. Wenn ich etwas Akustisches machen will, greife ich zu meiner großen Guild F-50. Das ist das Arsenal, auf das ich schon ewig zurückgreife, einfach weil ich damit prima zurechtkomme. Auch auf diesem Album.

Also verwendest du – was elektrische Gitarren betrifft – primär Fender?
Nicht nur. Über die Jahre habe ich viele unterschiedliche Gitarren bekommen. Die meisten als Geschenk von Freunden und Kollegen, zwei wurden mir sogar vererbt. Aber die, die ich wirklich verwende, sind eigentlich nur eine Flaxwood und die drei Fender-Gitarren, die in A, A-Moll und G gestimmt sind – und die ich je nachdem verwende, was ich gerade für einen bestimmten Song brauche. Da gibt mir mein Techniker dann einfach das passende Modell, statt dass wir lange rumstimmen.
Genauso verfahren wir bei den akustischen Gitarren, eben den Guilds. Die mit dem Open Tuning kommt zum Beispiel bei ‚Down The Hall‘ zum Einsatz, die andere ist für bluesigere Sachen wie ‚Angel From Montgomery‘. Das sind die Teile, auf die ich am häufigsten zurückgreife: Meine Strats und die Guilds. Außerdem habe ich noch eine wunderbare Resonator, die mir von Larry Pogreba angefertigt wurde. Sie klingt einfach großartig.

Wie kommt es, dass du nie zur Sammlerin geworden bist? Hat dich das nie interessiert oder ist das eher ein Männer-Ding?
Irgendwie hat sich das nie ergeben. Ich habe noch eine 51er Gibson, die ich auf Tour mit John Prine erworben habe. Da sind wir vor einer Show in eine Pfandleihe in Portland, Oregon, gegangen und haben diese wunderschöne Gitarre gefunden, die keine Pickups hatte. Ich habe sie restaurieren lassen und spiele sie jetzt oft zuhause. Genau wie eine Martin-Parlor von 1878, die mir mal jemand geschenkt hat. Ein tolles Teil, das ich wahnsinnig gerne spiele, aber das zu alt und zu wertvoll ist, um mich auf Tournee zu begleiten.
Insofern würde ich mich nicht als Sammlerin bezeichnen, auch wenn ich noch ein weiteres Juwel habe: Eine Gibson ES-175 von 1956, die ich gelegentlich auf der Bühne einsetze. Das war es dann auch. Ich habe eigentlich nur Sachen, die ich tatsächlich verwende. Und dazu gehört auch die braune Strat – sie hat mich nie im Stich gelassen.
Was macht sie so besonders und wie lange spielst du sie schon?
Sie ist wie ein guter, alter Freund. Eine 65er Strat, die ich 1969 gekauft habe – um drei Uhr morgens, nach dem Gig eines guten Freundes. Er bot sie mir für 120 Dollar an, und ich habe sie allein deshalb geliebt, weil sie damals nicht lackiert war. Ich hielt das für wahnsinnig cool – und tue das bis heute. Von daher hat es zum einen mit Sentimentalität zu tun, zum anderen auch damit, dass sie sich hervorragend spielt und einfach toll klingt.
Dann ist sie die Vorlage für deine Signature-Fender?
Ja, sie hat dieselben Texas-Special-Pickups. Doch der Sound, den dieses alte Holz erzeugt, lässt sich nicht replizieren. Ansonsten habe ich das Modell nach meinen Vorstellungen designen und eine richtig coole Farbe wählen können. Die Bundstäbe, den Hals und die Pickups habe ich übernommen – und doch klingt es nicht exakt wie meine Gitarre. Dennoch liebe ich die Signature-Instrumente.
Und sei es nur, weil ich sie regelmäßig für wohltätige Zwecke stifte oder versteigere und damit kostenlosen Gitarrenunterricht für Kinder aus armen Nachbarschaften in den USA finanziere. Daran beteiligt sich Fender ebenfalls. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, um finanziell benachteiligte Talente zu fördern, die sonst nie die Gelegenheit hätten, ihre künstlerische Seite zu erkunden.
Sie datiert von 1996 und ist das erste Signature-Modell, das Fender je für eine Frau gebaut hat. Das ist doch ein Statement für sich – eben, dass Gitarren immer noch eine Männerdomäne sind, oder?
Ich schätze schon. Obwohl: Es sind über die Jahre deutlich mehr Frauen geworden, die in Bands spielen. Nur: Die wenigsten von ihnen sind halt Lead-Gitarristinnen, und noch weniger in angesagten Bands. Das ist einfach so. Aber in letzter Zeit hat sich ein bisschen etwas verändert. Zum Beispiel dadurch, dass Beyoncé oder Jack White ausschließlich auf weibliche Musiker zurückgreifen – und es Gratis-Unterrichts-Videos im Internet gibt, die wirklich hilfreich sind.
Außerdem sind eine Menge günstiger und wirklich brauchbarer Instrumente verfügbar. Das trägt dazu bei, dass heute mehr Frauen in Bands agieren als es früher der Fall war. Und Gitarrenfirmen wie Gretsch und Co. haben das längst realisiert. Deshalb gibt es inzwischen zumindest ein paar Signature-Modelle von weiblichen Gitarristinnen.
Wie hat sich dein Spiel über die Jahre verändert? Welche Unterschiede kannst du da feststellen?
Wenige. Ich spiele Slide, so lange ich denken kann. Die letzte große Zäsur oder Veränderung war, als ich mich mit Lowell George von Little Feat angefreundet hatte und er mir einen MXR-Kompressor gab, damit ich die Nachklingzeit meiner Slide-Noten verlängern konnte. Also so, wie er das tat – was mich echt fasziniert hat. Ich fragte ihn, wie er das hinkriegt, weil die Art, wie ich auf der akustischen oder elektrischen Gitarre spiele, nicht viel anders war als seine.
Und ich bewege mich von jeher innerhalb dieser Bandbreite, über die wir gerade gesprochen haben und an der ich mich seit Jahrzehnten abarbeite. Deswegen liebe ich es auch, neue Spieler und neue Wege beim Arrangieren von Songs zu finden, auf die ich bislang nicht gekommen bin. So ging es mir bei diesem Song von Gerry Rafferty, der in den 70ern ein Riesenhit war und den ich auf ‚Slipstream‘ in einen Reggae-Song namens ‚Right Down The Line‘ verwandelt habe. Das ist es, was ich liebe: Nämlich Songs so umzustricken, dass sie ein bisschen anders sind als die Originale und dann noch mein Slide darüber zu legen. Das ist meine Ausdrucksform – das ist meine Kunst.
(erschienen in Gitarre & Bass 05/2022)