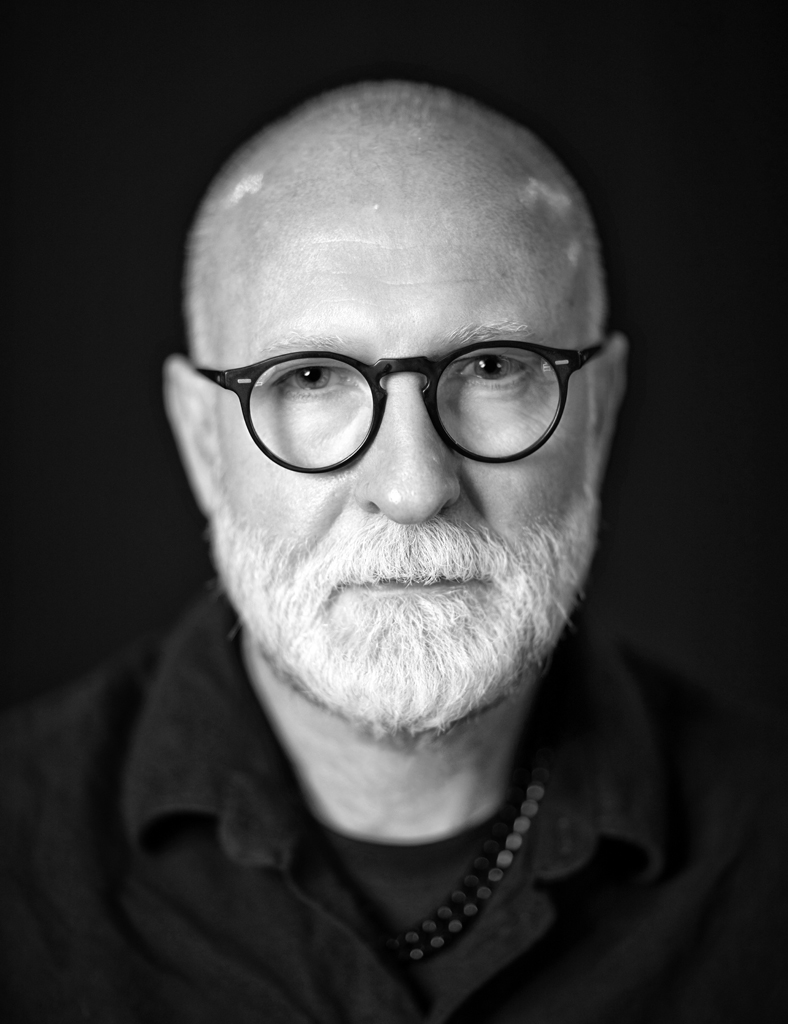 (Bild: Ryan Bakerink)
(Bild: Ryan Bakerink)
Die Sessions zu seinem neuen Album ‚Here We Go Crazy’ wird Bob Mould so schnell nicht vergessen: Sie waren seine letzte Begegnung mit Produzenten-Legende Steve Albini, ein gezieltes therapeutisches Austoben und eine Konfrontation mit winterlichen Extremtemperaturen. Die Folge: Tiefgefrorene Gitarren und elf Songs, die den Spirit von Hüsker Dü beschwören.
Viereinhalb Jahre – so lange hat Onkel Bob keine neue Musik veröffentlicht. Die längste Pause zwischen zwei Alben in seiner gesamten, fünf Dekaden umspannenden Karriere. Aber: Kein Ausdruck von Schreibblockade oder Lustlosigkeit, als vielmehr logische Folge der Pandemie, die das ehemalige Mastermind von Hüsker Dü und Sugar mit sporadischen Konzerten in den USA überbrückt hat.
Genau dieses Szenario dominiert auch seinen 16. Alleingang, der im Frühjahr 2024 in den Chicagoer Electrical Audio Studios von Steve Albini entstanden ist – kurz vor dessen Tod: Elf Songs, die die Post-Covid-Stimmung zwischen Ost- und Westküste einfangen: Die Unsicherheit, Verbitterung und Zukunftsängste. Denen begegnet der inzwischen 64-jährige Altmeister des Underground-Rocks mit Solidarität, Verständnis und Zuversicht. Motto: Kopf hoch, das Leben geht weiter.
Deshalb auch das Coverartwork, das ihn im Sonnenaufgang zeigt, während alles um ihn herum stockfinster ist. Ein symbolträchtiges Image – und dazu passt auch die musikalische Herangehensweise. ‚Here We Go Crazy’ ist pures Adrenalin; mit durchgetretenem Gaspedal, ruppig-rauen Riffs, polternden Drums (inklusive Keith-Moon-Hommage in ‚Fur Mink Augurs’) und kratzig-kehligem Gesang. Natürlich mit den obligatorisch-starken Melodien, aber ohne ausgefeilte Arrangements oder akustische Zuckerwatte.
Bob, warum hast du für dieses Album so lange gebraucht – wo lag das Problem?
Ich denke, es hatte damit zu tun, dass die Welt zum Erliegen gekommen ist. Oder besser gesagt: Meine persönliche Welt. Denn der Zyklus, in dem ich mich seit meinen frühen 20ern bewegt habe, wurde schlagartig unterbrochen. Er bestand quasi mein gesamtes erwachsenes Leben darin, Musik zu schreiben, sie aufzunehmen, ein paar Interviews zu geben und danach so viel wie möglich zu touren.
Wobei die letzte Show das Ende des betreffenden Zyklus ist. Und der nächste beginnt mit dem Schreiben neuer Stücke. Bis zur Pandemie war das mein Leben – bis plötzlich alles anders wurde. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum es diesmal länger gedauert hat. Denn normaler Weise habe ich zwischendurch immer ein paar Gigs gespielt, bei denen ich neues Material ausprobiert habe – einfach, um zu sehen, wie die Leute reagieren.
Erst dann habe ich ein Album zusammengestellt. Und diesen Luxus gab es für ein paar Jahre nicht. Dabei finde ich es extrem wichtig, so einen Schritt kurz vor den Aufnahmen einzulegen – auch damit sich die Band ans neue Material gewöhnt und eingespielt ist, wenn es ins Studio geht. Das war länger nicht machbar. Und deshalb habe ich in der Zeit halt so viel geschrieben wie irgend möglich. Das war das einzige, was ging als die Welt zum Stillstand kam.
Also hast du zuletzt wieder so viel live gespielt, wie eben möglich?
Und das schon ab 2022, was zunächst gar nicht so leicht war, weil die Leute – verständlicherweise – noch Angst hatten, zu Konzerten zu gehen. Und wegen des zögerlichen Zuspruchs war das eine echte Herausforderung. Trotzdem waren wir 22, 23 und 24 viel in den USA unterwegs.
Nicht zuletzt weil wir mussten – wir hatten ja keine anderen Einnahmequellen. Aber ich habe es dennoch genossen – gerade mit den neuen Songs im Gepäck. Und ich habe den Leuten, die dort waren, angesehen, wie sehr sie sich über dieses Gemeinschaftserlebnis in Sachen Live-Musik gefreut haben. Eben nach zwei Jahren, in denen das komplett brachlag.
Es hatte ein bisschen was davon, die Isolation hinter sich zu lassen und wieder anzufangen, zu leben. Ich fand es sehr spannend, das zu beobachten, mir die Geschichten anzuhören und dieses kollektive Gefühl in mich aufzusaugen.

Du hast im Studio von Steve Albini aufgenommen. Wie kommt es, dass du zwar seine Räumlichkeiten, aber nicht seine Dienste als Produzent oder Techniker in Anspruch genommen hast?
Ich habe feste Leute, mit denen ich arbeite. Das war also nichts gegen Steve, der für mich zu den wichtigsten Produzenten der Welt gehörte. Wir haben uns fast 40 Jahre gekannt. Und er hatte ein wirklich wunderbares Studio. Insofern ist sein überraschender Tod im letzten Jahr ein tragischer Verlust.
Er hat ein paar umwerfende Sachen gemacht – mit seiner eigenen Band, aber auch mit dem Studio, mit seiner Philosophie in Sachen Musik und seiner Sicht auf das Business. Wir hatten zwar unterschiedliche Ansichten, was manche Dinge betrifft, aber haben einander geschätzt und unterstützt. Er hat etlichen Leuten geholfen und sogar gearbeitet, ohne dafür bezahlt zu werden. Wer kann das schon von sich behaupten?
Darf man fragen, was du auf dem Album spielst – also was Gitarren, Verstärker und Effekte betrifft?
Fürs Studio hatte ich eigentlich nur zwei Gitarren dabei – meine graue und meine schwarze American Standard Strat Plus aus den späten 80ern. Doch als ich in Chicago gelandet bin, herrschten da minus 30 Grad, es blies ein eisiger Wind und die Gitarren standen stundenlang im Schnee neben dem Flugzeug. Man hatte sie dort vergessen.
Insofern hat es drei Tage gedauert, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Ich musste sie sogar von einem Gitarrenbauer warten lassen, weil sie buchstäblich erfroren waren. Und was Amps betrifft, habe ich einen Fender Silverface Deluxe Reverb verwendet – einen Reissue. Außerdem einen Fender Hot Rod DeVille, den mir ein Freund geliehen hat, und einen Blackstar Artisan, den ich im Studio vorgefunden habe.
Effekte-Pedale hatte ich keine dabei – außer meinen handgefertigten Distortions. Also keine Kompressoren, keine Delays, keinen Hall. Es war einfach die Gitarre ins Distortion-Pedal und dann in den Verstärker. Aber diesmal eben keine großen Türme, sondern kleine Amps, die – meiner Meinung nach – einen viel sauberen Ton haben.
Was hat dich dazu gebracht, deine eigenen Verzerrerpedale zu bauen, anstatt auf das zurückzugreifen, was der Markt zu bieten hat?
Es gibt da diese Firma im australischen Brisbane. Sie heißt TYM Guitars – nach dem Besitzer. Und der hat mir vor über einer Dekade ein Distortion-Pedal basierend auf den alten MXR-Distortion-Plus-Pedals gebaut. Die habe ich zu Zeiten von Hüsker Dü verwendet – und mittlerweile sind sie verdammt schwer zu bekommen bzw. selten in gutem Zustand.
Was er mir da gebastelt hat, habe ich geliebt: Eine viel effizientere und robustere Version eines MXR Distortion Plus mit einem einmaligen Sound. Ich habe dann nach und nach gute geschäftliche Beziehungen zu Tym aufgebaut und er hat angefangen, unterschiedliche Versionen des Pedals zu bauen – jede ein bisschen besser. Die habe ich dann auch via Mail-Order an meine Fans verkauft.
Damit jeder deinen Sound replizieren kann? Ist das nicht kontraproduktiv?
(lacht) Das könnte man so auslegen. Aber hey, eingefleischte Fans wollen nicht nur wissen, was du spielst, sondern das auch selbst so hinkriegen. Und deshalb habe ich sie direkt verkauft, damit sie keine teuren Importe aus Australien erwerben müssen. Das fand ich fair.
Und es gab drei verschiedene Modelle. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, sie gründlich zu überholen und neu auf den Markt zu bringen, aber dafür – fürchte ich – ist momentan nicht der richtige Zeitpunkt.
Was macht die Fender American Stratocaster zu deiner bevorzugten Gitarre – warum hast du dich dafür entschieden? Und wann war das?
1988, nach dem Ende von Hüsker Dü. Damals habe ich auf einer Farm in Nord-Minnesota gelebt. Eines Tages, als ich aus der Stadt nach Hause gefahren bin, sah ich eine Werbung für einen kleinen Gitarrenladen in Forest Lake. Eine verschlafene Kleinstadt.
Also bog ich vom Highway ab, bin da rein und habe diese blaue Strat entdeckt, die die Leute wahrscheinlich noch aus meiner Zeit mit Sugar kennen. Die habe ich in diesem Laden am sprichwörtlichen Arsch der Welt gefunden. Ich habe sie von der Wand genommen und einmal kurz gespielt – ohne Verstärker und für vielleicht 15 Sekunden.
Dann habe ich sie auf die Kassentheke gelegt und gesagt: „Ich würde gerne diese Gitarre kaufen.” So einfach war das. Seitdem habe ich einige weitere Exemplare erworben – also vielleicht sieben oder acht von den American Standard Strat Plus. Die meisten sind von 1989, einige von 1987 oder 1988. Und ich finde, sie spielen sich sehr angenehm. Also habe ich mich daran gewöhnt, und sie sind meine Hauptgitarren.
Sich für eine E-Gitarre zu entscheiden, ohne sie durch einen Verstärker zu spielen, ist ziemlich ungewöhnlich. Was hast du gehört, dass sie so perfekt für dich gemacht hat?
Na ja, ich habe mir keine Sorgen um die Pickups gemacht – weil man die immer wechseln kann. Es war eher der natürliche Klang der unverstärkten Gitarre, der mich begeistert hat. Ich fand sie wunderbar und sie war leicht zu spielen. Das waren die entscheidenden Kriterien für mich.
Befindet sie sich noch in deinem Besitz?
Oh ja, na klar. Und ich spiele sie immer noch gerne. Nur: Sie bleibt mittlerweile zu Hause. (kichert) Sie reist nirgendwo mehr hin. Das hat sie sich verdient. Schließlich ist sie Teil meiner DNA oder meines Sounds. Ein wunderbares Instrument. Und viele, die ich seitdem gekauft habe, sind ähnlich gut. Aber diese erste ist etwas Besonderes, deshalb behandle ich sie auch ein bisschen besser als die anderen.
Was wurde aus den Flying Vs deiner Hüsker-Dü-Jahre? Hast du die noch?
Aber klar. Ich spiele sie nur nicht mehr, weil sie mittlerweile museumsreif sind.
Was hat dich daran gereizt?
Als ich anfing, stammte meine allererste Gitarre aus einem Kaufhaus-Katalog: Eine SG-Kopie, die nicht sonderlich teuer war. Aber es war halt das, was ich von meinen Eltern bekommen habe – und solche Katalog-Gitarren waren damals ganz normal. Viele Bekannte von mir haben damit angefangen. Und nachdem ich ein paar Jahre darauf gespielt und mir alles beigebracht hatte, wollte ich eine echte.
Also bin ich in der Kleinstadt in Upstate New York, in der ich aufgewachsen bin, in den lokalen Laden für Musikinstrumente gegangen und habe etwas Besseres gesucht als das, was ich bislang hatte. Da hing dann ein Poster für Ibanez-Gitarren. Es zeigte Sylvain Sylvain von den New York Dolls, der so ein Modell spielte. Und da ich ein Fan der Dolls war – vor allem von Johnny Thunders –, fühlte ich mich davon angesprochen. Welch Zufall: Genau die Gitarre war in dem Laden im Angebot. Also sagte ich: „Die kaufe ich.” So bin ich zu meiner ersten Flying V gekommen.
Sylvain und Thunders waren nicht deine einzigen Gitarrenhelden – angeblich zählten auch Pete Townshend von The Who, Pete Shelley von den Buzzcocks und Johnny Ramone dazu. Stimmt das?
Die drei gehörten definitiv dazu. Es gibt auch noch mehr Gitarristen, vor denen ich großen Respekt habe, aber Townshend hatte definitiv riesigen Einfluss auf mein Spiel. Er hat mir gezeigt, was es heißt, gleichzeitig Rhythmus- und Lead-Gitarre zu spielen.
Dagegen war Pete Shelley eher ein Vorbild in Sachen Songwriting und Johnny Ramone war das Genie hinter den Ramones – eine Band, die die moderne Musik revolutioniert hat. Ich schätze mich wahnsinnig glücklich, dass ich sie nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums live erleben durfte. Es war ein 45-minütiger Gig als Support für Iggy Pop. Und diese Dreiviertelstunde hat mein Musikverständnis für immer verändert.
Wann erleben wir Bob Mould wieder in Deutschland?
Wir schauen gerade, ob wir das noch dieses Jahr hinkriegen – was ich sehr begrüßen würde. Und das nicht aus finanziellen Gründen. In Europa zu touren ist ein wahnsinnig teures Unterfangen geworden. Das beginnt mit der Anmietung von Bussen und Crew, aber auch Hotels und Benzin – alles ist regelrecht explodiert. Von daher stellt das eine echte Herausforderung dar. Aber wir versuchen trotzdem, das hinzubekommen – so, dass ich möglichst nicht draufzahle.
(erschienen in Gitarre & Bass 04/2025)